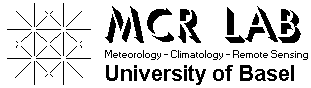
Modellierung der sommerlichen Schwülebelastung
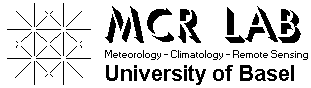
Die Modellierung der sommerlichen Schwülebelastung im südlichen Oberrheingraben wurde unter Verwendung der durch das MCR Lab erstellten Landnutzungsklassifikation durch Herrn Dr. G. Jendritzky (1995) und Frau A. Grätz von der Zentralen Medizin-Meteorologischen Forschungsstelle des Deutschen Wetterdienstes in Freiburg mit dem Urbanen Bioklimamodell UBIKLIM erarbeitet. Der folgende Textteil ist daher in vielen Passagen einer Publikation von Jendritzky und Grätz (1995) entnommen, die sich auf diese Analyse bezieht.
Das Bioklima ist die Summe aller auf lebende Organismen wirkenden Faktoren des Klimas. Die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit des Menschen werden davon beeinflußt. Der gesunde Mensch erbringt die Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichen atmosphärischen Bedingungen meist unbemerkt, während das Anpassungsvermögen von empfindlichen Personen, älteren und kranken Menschen sowie von Schwangeren und Kindern häufig überfordert wird. Epidemiologische Untersuchungen bestätigen solche Wirkungen extremer Bedingungen (Kälte, Hitze, Luftverschmutzung, Wetterwechsel) auf Morbidität und Mortalität (Jendritzky 1992, 1993). Als Beispiel zeigt die Abbildung Beziehungen zwischen Mortalitätsdaten aus Baden-Württemberg und den komplexen atmosphärischen Bedingungen der Wärmeabgabe des Menschen unter Verwendung des PMV-Wertes (Predicted Mean Vote), einer komplexen Klimagröße, bei der neben der Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit auch der Strahlungs- und Wärmehaushalt und der Wind berücksichtigt wird.
Im Hinblick auf Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit des Menschen ist dabei das Bioklima von planerischem Interesse.
Für eine humanbioklimatologische Analyse und Bewertung des thermischen Wirkungskomplexes, d.h. der meteorologischen Bedingungen der Wärmeabgabe, wird das "Klima-Michel-Modell" (Jendritzky et al. 1990) verwendet. Es gilt neben anderen vollständigen Energiebilanzmodellen des Menschen (VDI 1995) als "state of the art". Das Modell liefert eine Aussage über das durchschnittliche subjektive Empfinden des Menschen. Der PMV-Wert (Predicted Mean Vote nach der Diskomfort-Gleichung von Fanger 1972) kann als Maß für die thermische Belastung des Organismus (Wärmebelastung, Kältestreß) aufgefaßt werden. Der Name "Michel" weist auf den Durchschnittsmenschen hin ( hier als männlich angenommen, Alter 35 Jahre, Größe 175 cm, Gewicht 75 kg). Das Verfahren verknüpft Wärmeproduktion aufgrund des aktivitätsabhängigen Energieumsatzes unter Berücksichtigung der Wärmeisolation der Bekleidung mit den für die Wärmeabgabe verantwortlichen meteorologischen Bedingungen, die von der Lufttemperatur, der Luftfeuchte, der Windgeschwindigkeit sowie den kurz- und langwelligen Strahlungsflüssen abhängen. Das Klima-Michel-Modell ist geeignet, auf der Basis von meteorologischen Daten physiologisch relevante Aussagen zu erzeugen.
Als typisches Verhalten wurde Spazierengehen (auf die Körperoberfläche bezogener Energieumsatz 116 Wm-2) angenommen. Für die Bekleidung galt als Wärmeisolation im Sommer 0,5 clo (1 clo = 0,155 m2KW-1).
Auch das Bioklima wird durch die natürlichen klimatologischen Wirkungsfaktoren ("Klimafaktoren") bestimmt (Schirmer 1981). Für gering auflösende Bioklimakarten spielt in der Regel die unterschiedliche Landnutzung für die Verteilung der einzelnen Bioklimate keine Rolle. Ein digitales Höhenmodell enthält die notwendigen Informationen, um über einen Regressionsansatz pixelweise das Bioklima zu berechnen (Jendritzky et al., 1990). Auf der Basis der 30-jährigen Meß- und Beobachtungsdaten (1951-1980) der Elemente Lufttemperatur, Taupunkt, Windgeschwindigkeit und Bewölkung an den 88 Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes in den alten Bundesländern einschließlich Berlin wurden über schrittweise Regressionen entsprechende Modelle entwickelt, mit denen anhand des Einflusses der Klimafaktoren die Eintrittswahrscheinlichkeit für Wärmebelastung bestimmt werden kann (Jendritzky, 1992b). Die Varianzerklärung liegt mit 86.2 % im Sommermodell erfreulich hoch. Diesen Modellen liegt eine Topographie im 1 km Raster zugrunde, auf deren Basis im Maßstab 1:1,5 Mill. die Karte "Das Bioklima in der Bundesrepublik Deutschland" entworfen wurde.
Für die hier dargestellten höher auflösenden Bioklimakarten muß zusätzlich der Einfluß unterschiedlicher Landnutzungen in die Regressionsansätze eingearbeitet werden. Dazu wurden die Analysebedingungen für die dreißigjährigen Meßreihen der meteorologischen Daten dergestalt geändert, daß die Effekte einer beschränkten Zahl von Landnutzungen parametrisiert den Ursprungsdaten aufgeprägt wurden. Hierdurch resultiert eine schlechtere räumliche Auflösung der Abbildung im Vergleich mit der Landnutzungsklassifikation.
Abbildung : Modellierte sommerliche Wärmebelastung im Untersuchungsgebiet Basel
Wärmebelastung tritt hauptsächlich bei sommerlichen, strahlungsreichen Hochdruckwetterlagen mit geringer Luftbewegung auf. Die Abbildung zeigt die Anzahl der Tage mit Wärmebelastung, wie sie im vieljährigen Durchschnitt von April bis Oktober am frühen Nachmittag zu erwarten ist. Für die Analyse wurde dabei der 16:00 Uhr MEZ-Termin als repräsentativ angesehen.
Erwartungsgemäß ist die Wärmebelastung am häufigsten im Gebiet von Basel und in der Oberrheinebene, während die höher gelegene Umgebung des Schweizer Jura und des Dinkelberges bereits deutlich seltener belastet sind. Darin spiegelt sich die Höhenabhängigkeit der Verteilung der Wärmebelastung wider. Abweichungen davon werden durch die orographische Lage und die Art der Landnutzung hervorgerufen. So muß in den Seitentälern des Schweizer Jura durch ihre windgeschützte, relativ zur Sonne günstig exponierte Lage bis in größere Höhen mit einer erhöhten Anzahl von Tagen mit Wärmebelastung gerechnet werden.
Die Auswirkungen unterschiedlicher Landnutzung zeigen sich am deutlichsten im Raum Basel und in der Rheinebene, wo die Topographie nur einen geringen Beitrag zur Verteilung der Wärmebelastung leisten kann. Die Wälder in den Rheinauen und die Hardtwälder nördlich von Basel zeichnen sich deutlich als Bereiche mit geringer Wärmebelastung ab. Verantwortlich ist dafür der Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und die geringere Temperatur, wodurch die eingeschränkte Ventilation überkompensiert wird. Entlang des Rheins wird die Schwülebelastung durch die im Vergleich zur Innenstadt niedrigeren Oberflächentemperaturen reduziert. In Siedlungsgebieten sind dagegen Tage mit Wärmebelastung noch häufiger anzutreffen als in den umliegenden Freiflächen. Aufgrund unterschiedlicher Bebauungsdichte lassen sich in Basel weitere Differenzierungen erkennen, wobei zunehmende Bebauungsdichte das Auftreten von Wärmebelastung begünstigt (Grätz et al., 1994).