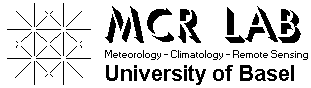
Flächendeckende Bestimmung der langwelligen Emission
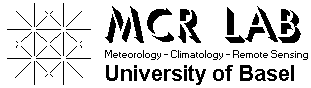
Die Erdoberfläche emittiert im langwelligen Wellenlängenbereich elektromagnetische Strahlung. Diese terrestrische Emission (El) kann nach dem Gesetz von Stefan-Boltzmann über die Oberflächentemperatur der emittierenden Fläche beschrieben werden:
Hierbei sind e der Emissionskoeffizient (bei natürlichen Oberflächen liegt er zwischen 0.91 und 0.98), sigma die Stefan-Boltzmann-Konstante (5.678 · 10-8 Wm-2K-4) und T die Oberflächentemperatur in Kelvin.
Die langwellige terrestrische Emission besitzt eine sehr große zeitliche und räumliche Variabilität, wodurch es sehr schwierig ist, ihre räumliche Varianz an meteorologischen Stationen meßtechnisch zu erfassen. Mit Satellitendaten des thermalen Infrarot ist dies jedoch jeweils für den Zeitpunkt des Satellitenüberfluges möglich. Die Oberflächentemperatur steht in der Regel in enger Wechselwirkung mit der Lufttemperatur der bodennahen Luftschicht.
Die langwellige Emission der Landoberfläche kann aus dem thermalen Kanal des LANDSAT-TM (Kanal 6, 10.4-12.5 micron ) bestimmt werden. Aus den digitalen Zahlenwerten (DG) kann unter Verwendung einer Kalibrationsformel die Strahlungstemperatur der Landoberfläche berechnet werden (Schott und Volchok 1985).
mit
Hierbei ist DG der Digitalwert im TM-Kanal 6 des LANDSAT-TM.
Da die Atmosphäre im selben Wellenlängenbereich Strahlung emittiert wie die Landoberfläche muß ihr Einfluß auf die Strahlungsmessung im Satelliten korrigiert werden. Diese Korrektur erfolgt wiederum höhenabhängig unter Verwendung des digitalen Geländemodells, um die unterschiedliche Mächtigkeit der Atmosphäre über dem südlichen Oberrheingraben bzw. den umrahmenden Bergländern (Schweizer Jura, Dinkelberg) zu berücksichtigen.
Das Ergebnis dieser Berechnung zeigt die folgende Abbildung. Im visuellen Vergleich mit der Landnutzungsklassifikation läßt sich die starke Abhängigkeit der langwelligen Emission von der Landnutzung erkennen. Die hochgradig versiegelten, eng verbauten Innenstadtbereiche und Industrieareale von Basel weisen hohe Emissionswerte auf. Höchste Werte besitzen die Bahnareale von Basel, Muttenz und Weil. Die hohen Emissionswerte, die mit hohen Oberflächentemperaturen korrespondieren, sind teilweise aus den physikalischenn Materialeigenschaften (Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität und Temperaturleitfähigkeit) der Oberfläche erklärbar. Von mindestens gleicher Bedeutung ist jedoch der Rückkoppelungseffekt mit den Teilkomponenten des lokalen Wärmehaushaltes. Fühlbarer und latenter Wärmefluß kompensieren die aus dem Strahlungshaushalt verfügbare Energie in Form von Temperaturerhöhung und Verdunstung. Stark verdunstende Flächen kühlen sich durch den Verdunstungsprozeß und besitzen daher nur mittlere Oberflächentemperaturen knapp über der Lufttemperatur. Den Flächen, bei denen die Verdunstung auf ein Minimum verringert ist oder die überhaupt nicht verdunsten (wie z.B. versiegelte innerstädtische Flächen an einem Hochsommertag), steht somit für die Erhöhung der Oberflächentemperatur und der Lufttemperatur der darüberliegenden Luftschicht bedeutend mehr Energie zur Verfügung. Dies wirkt sich schließlich bis in die bioklimatischen Bedingungen aus.
Abbildung : Aus Satellitendaten abgeleitete langwellige Emission des Untersuchungsgebietes Basel