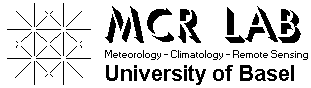
Einleitung
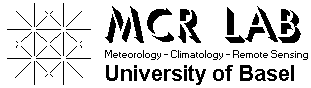
Das Klima einer Stadt oder eines städtischen Agglomerationsraumes ist ein eindrucksvolles Beispiel einer anthropogen verursachten, räumlich begrenzten Klimamodifikation. Die Zahl wissenschaftlicher Arbeiten zu diesem Thema ist inzwischen unüberschaubar, u.a.Landsberg (1981), Oke (1982 und 1987), WMO (1986), Kuttler (1985, 1987 und 1988), Bründl et al. (1986), Horbert (1986), Nübler (1979), Jendritzky und Nübler (1983), Menz (1987), Parlow (1985), Stock (1988), Wanner (1983 und 1991), Weischet (1975, 1979 und Landsberg (1981), Oke (1982 und 1987), WMO (1986), Kuttler (1985, 1987 und 1988), Bründl et al. (1986), Horbert (1986), Nübler (1979), Jendritzky und Nübler (1983), Menz (1987), Parlow (1985), Stock (1988), Wanner (1983 und 1991), Weischet (1975, 1979 und 1980).
Weltweit werden Anstrengungen unternommen, den Einfluß der Stadt auf das urbane Klima besser zu verstehen und in Form von numerischen Modellen zu simulieren. Wenn man auch in der Zwischenzeit hierbei sehr weit gekommen ist, so besteht dennoch auch weiterhin ein gewaltiger Handlungsbedarf für weitere Forschungen, da die Anforderungen seitens der Stadtplanung an die Klimatologen sich auf großmaßstäbige Aussagen zum Stadtklima beziehen, die nur in Maßstäben von 1 : 25000 bis 1 : 5000 zu erfüllen sind. Bei räumlichen Auflösungen im Bereich weniger Meter bestehen aber vielfältige Beeinflussungen, die z.T. noch unerforscht sind. Ein weiteres Defizit ist das Fehlen der für diesen Maßstab notwendigen Eingangsinformation. Diese muß
Die Stadtklimatologie hat sich zur Aufgabe gemacht, die durch die menschlichen Aktivitäten Wohnen, Arbeiten und Verkehr verursachten Veränderungen des Klimas zu untersuchen und ihre Ergebnisse für Entscheidungen in der Stadt- und Regionalplanung aufzubereiten. Dies bedeutet, daß neben der Beschreibung des klimatischen Istzustandes auch eine Vorhersage getroffen werden muß, wie sich das städtische Klima, z.B. infolge von Bebauungsmaßnahmen, ändern könnte. Die Berücksichtigung des Faktors Klimas ist heute fester Bestandteil des Umweltrechtes.
Die Fernerkundung mit hochauflösenden Satellitensystemen (ERS-1, LANDSAT-TM) ist in der Lage, einen bedeutenden Teil der für die Erfüllung der aufgelisteten Forderungen notwendigen Datengrundlagen bereitzustellen.
Die große und weiter zunehmende Nachfrage nach kurzfristig zu erstellenden, flächendeckenden und immer großmaßstäbigeren Aussagen zum Stadtklima kann nur noch durch numerische Klimamodelle unter Einbeziehung von Satellitendaten befriedigt werden. Die Pilotstudie ERSCliP (ERS-Climate Project) hat sich zum Ziel gesetzt, mit Hilfe von multisensoralen Satellitendaten des ERS-1 der Europäischen Weltraumbehörde ESA und des amerikanischen Satelliten LANDSAT-Thematic Mapper (TM) stadtklimarelevante Datensätze, die als Inputdaten für Stadtklima- oder Bioklimamodelle verwendet werden können, in hoher räumlicher Auflösung abzuleiten. Durch eine hoch differenzierte Landnutzungsklassifikation, die mit Daten des ERS-1 und des LANDSAT-TM erstellt werden kann, läßt sich eine durch die unterschiedliche Oberflächenbedeckung (Bebauung, Bewuchs etc.) verursachte innerstädtische Klimadifferenzierung flächendeckend ableiten, da sich das Klima einer dicht verbauten und hochgradig versiegelten Innenstadt von dem eines stadtrandnahen Einzelhausgebietes mit hohem Vegetationsanteil unterscheidet. Die Struktur der städtischen Baukörper beeinflußt direkt die Temperatur- und Luftfeuchteverteilung, aber auch den Strahlungshaushalt und die Oberflächenrauhigkeit und somit das Windfeld. Mit Hilfe von klimatischen Kenngrößen, die den städtischen Realnutzungsklassen zugeordnet werden können, entsteht eine Vorlage für eine sog. synthetische Klimafunktionskarte (Stock 1988, Stock, und Beckröge 1985) , wie sie operationell in vielen Planungsbehörden eingesetzt wird (z.B. Kommunalverband Ruhrgebiet). Diese Informationen finden auch Eingang in bioklimatischen Modellen, wie z.B. UBIKLIM vom Deutschen Wetterdienst (Jendritzky 1992, Jendritzky und Grätz 1995, VDI 1995) . Darüberhinaus lassen sich aus Satellitendaten direkt Informationen ableiten, die als Inputdaten für Stadtklimamodelle verwendet werden können (z.B. aerodynamische Rauhigkeit, Oberflächentemperaturen, langwellige Wärmestrahlung, Albedo).
In der Grundschicht der Atmosphäre, d.h. in den etwa untersten 1000 m der sog. atmosphärischen Grenzschicht verursacht die Landnutzung, bzw. die mit ihr verbundene Rauhigkeit und die vertikale thermische Schichtung der Luft einen erheblichen Einfluß auf die Strömungsbedingungen. Die genaue Kenntnis der Strömungsbedingungen stellt heute für viele Anwendungsaspekte eine wichtige Grundlage dar. Bei ebenem Gelände ohne höheren Bewuchs oder Gebäudekomplexe folgt die Änderung der Windgeschwindigkeit mit der Höhe bis etwa 50 m über Grund bei thermisch neutraler Schichtung der Atmosphäre folgendem Gesetz:
Hierbei ist z die Meßhöhe über Grund, z0 die vom Bewuchs bzw. der Landnutzung abhängige aerodynamische Rauhigkeit (oder Rauhigkeitslänge), k=0.4 die von Karman-Konstante und u* die Schubspannungsgeschwindigkeit. Die Rauhigkeitslänge gibt an, in welcher Höhe über Grund das vertikale logarithmische Windprofil den Wert 0 annimmt. Ist die Oberflächenbeschaffenheit durch eine ausgeprägte Vertikalstruktur charakterisiert, wie es z.B. bei Wäldern oder in urbanen Gebieten der Fall ist, und somit die für die Berechnung des Windprofils zu berücksichtigende Oberfläche gegenüber der Erdoberfläche vertikal versetzt, so wird in obiger Gleichung ein weiterer Wert, die sog. Nullpunktverschiebung d (zero plane displacement) berücksichtigt. Die Gleichung für das vertikale Windprofil lautet dann:
Die Kenntnis der Rauhigkeitslänge und der Nullpunktverschiebung in hinreichender räumlicher Auflösung ist eine wichtige Voraussetzung für die Modellierung von Windfeldern. Gegenüber herkömmlichen Verfahren der Digitalisierung von Kartenwerken oder Luftbildern bieten Satellitendaten eine preisgünstige, rasche und zeitlich homogene Möglichkeit zur Aktualisierung der Landnutzung und der aerodynamischen Rauhigkeit von großen Flächen. Der Einsatz von ERS-1-SAR-Daten ermöglicht in Kombination mit Daten optischer Sensoren eine klimatologisch relevante Landnutzungsklassifikation. Ausgehend von einer Klassifizierung auf der Basis von LANDSAT Thematic Mapper läßt sich durch Hinzunahme von ERS-1-SAR-Daten in urbanen Räumen eine Erhöhung des Differenziertheitsgrades städtischer Strukturen und eine Steigerung der Klassifikationsgenauigkeit erreichen. Hierdurch sind präzisere Datensätze für die Planung und Modellierung stadtklimatischer Phänomene ableitbar.
Die entwickelten Methoden eignen sich zur Anwendung in folgenden Bereichen:
Die Forschungsgruppe für die Pilotstudie ERSCliP am MCR Lab der Universität Basel setzte sich wie folgt zusammen:
Wissenschaftliche Projektleitung : Prof. Dr. Eberhard Parlow
Wissenschaftliche Projektkoordination : Dr. Dieter Scherer
Wissenschaftliche Projektbearbeitung : Dipl.Inf. Horst-Dieter Beha
Studentische Mitarbeiter : Dipl.Geogr. Franziska Siegrist, Dipl.Geogr. Nathalie Ritter